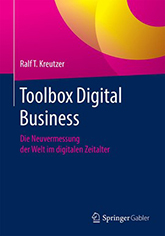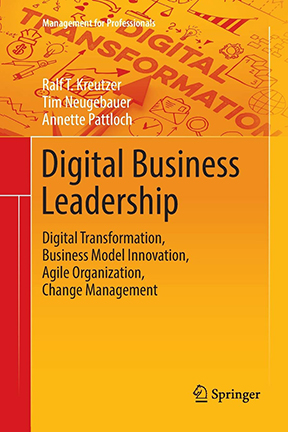Über den Autor | Ralf T. Kreutzer
Professor für Marketing | Berlin School of Economics and Law
Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer ist seit 2005 Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht/Berlin School of Economics and Law. Parallel ist er als Trainer, Coach sowie als Marketing und Management Consultant tätig. Er war 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Bertelsmann (letzte Position Direktor des Auslandsbereichs einer Tochtergesellschaft), Volkswagen (Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft) und der Deutschen Post (Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft) tätig, bevor er 2005 zum Professor für Marketing berufen wurde.
Professor Kreutzer hat durch regelmäßige Publikationen und Keynote-Vorträge (u.a. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Singapur, Indien, Japan, Russland, USA) maßgebliche Impulse zu verschiedenen Themen rund um Marketing, Dialog-Marketing, CRM/Kundenbindungssysteme, Database-Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Digitaler Darwinismus, Digital Branding, Dematerialisierung, Change-Management, Künstliche Intelligenz, Agiles Management, strategisches sowie internationales Marketing gesetzt und eine Vielzahl von Unternehmen im In- und Ausland in diesen Themenfeldern beraten.
Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Toolbox für Marketing und Management“, „Künstliche Intelligenz verstehen“ (2019, zusammen mit Marie Sirrenberg), „B2B-Online-Marketing und Social Media (2. Aufl., 2020, zusammen mit Andrea Rumler und Benjamin Wille-Baumkauff), „Voice-Marketing“ (2020, zusammen mit Darius Vousoghi), „Die digitale Verführung“ (2020), „Kundendialog online und offline“ (2021), „Praxisorientiertes Online Marketing“ (4. Auflage, 2021), „Social-Media-Marketing kompakt“ (2. Aufl., 2021), „E-Mail-Marketing kompakt“ (2. Aufl., 2021), „Online-Marketing – Studienwissen Kompakt (3. Aufl., 2021) und „Toolbox für Digital Business“ (2021).
Darüber hinaus leitet Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer die berufsbegleitende Ausbildung zum Chief Digital Officer (CDO) sowie das Seminar Nachhaltige Unternehmensführung bei der Bitkom Akademie.
www.ralf-kreutzer.de
Literatur-Empfehlungen
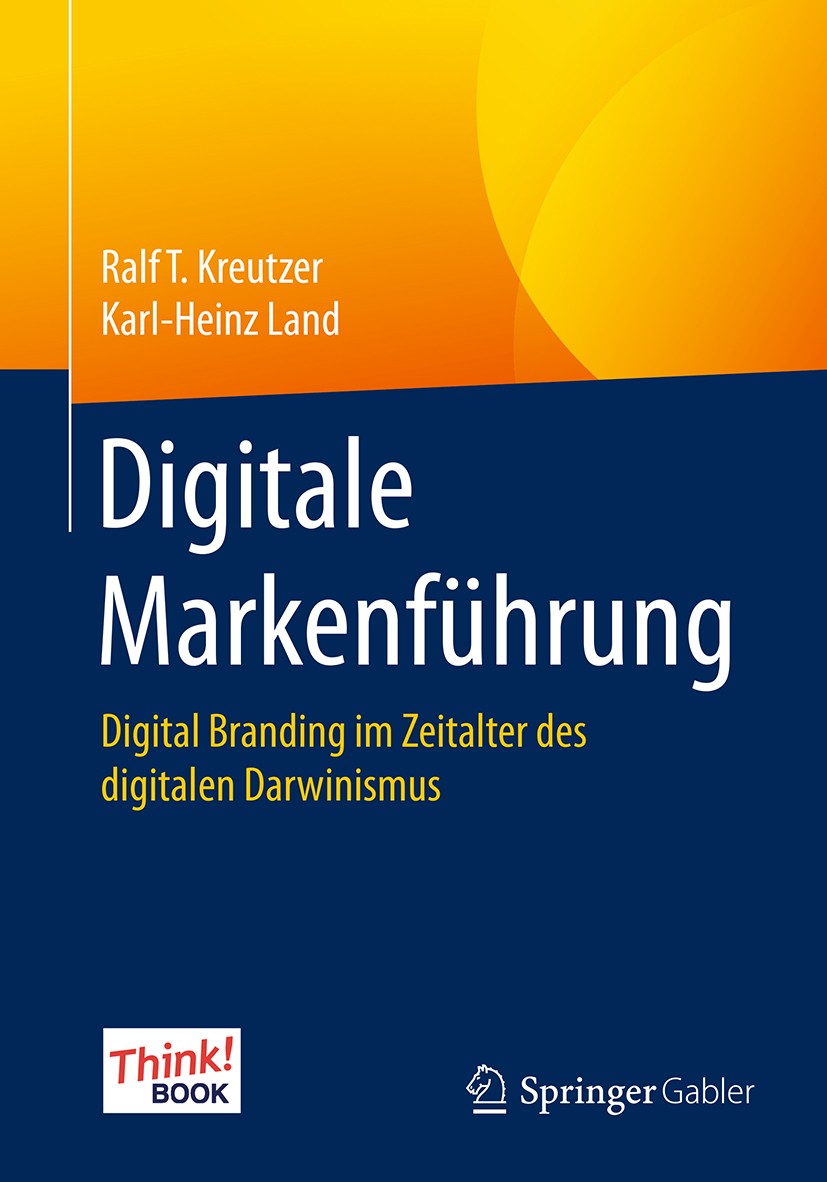
Digitale Markenführung
Digital Branding im Zeitalter des digitalen Darwinismus
Relevante Anforderungen an Unternehmen und Unternehmensführung
Shorts Facts
- ESG-Kriterien sind für alle Unternehmen von Bedeutung
- Die Einhaltung der ESG-Anforderungen beeinflusst Finanzanlagen
- ESG-Aspekte fließen – allmählich – auch in Kaufentscheidungen ein

ESG-Kriterien als Anforderungsprofil für Unternehmen und Unternehmensführung
Immer häufiger können wir in den meinungsbildenden Medien etwas zu den ESG-Kriterien lesen. Diese Kriterien werden häufig im Kontext von Finanzanlagen genannt – aber zunehmend auch als Maßstab für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung im 21. Jahrhundert. Doch worum geht es hier eigentlich? Und welche Relevanz haben diese Kriterien für mein eignes Unternehmen bzw. für mein unternehmerisches Handeln?
Wofür stehen die Buchstaben E, S und G?
Diese drei Buchstaben definieren weitere Verantwortungsbereiche von Unternehmen, um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts Rechnung zu tragen. Heute reicht es nicht mehr aus, ein Unternehmen „nur“ langfristig profitabel zu führen. Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist allerdings noch immer Voraussetzung, um langfristig am Markt überleben zu können. Heute sind jedoch zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Diese neuen Anforderungen werden immer stärker von Seiten der Anleger erhoben – und allmählich auch von Seiten der Kunden (siehe auch aktuelle Bitkom-Publikationen zum Umweltschutz). Unternehmen, denen der Geldhahn abgedreht wird oder deren Kunden abwandern, können langfristig auch nicht überleben. Folglich geht es darum, neben einem legitimen Gewinnstreben weitere Anforderungen zu erfüllen. Diese werden mit den ESG-Kriterien beschrieben.
- „E“ für Environment i. S. eines umweltverträglichen/umweltschonenden Handelns
- „S“ für Social i. S. eines Verhaltens, das nicht nur den Aspekten Arbeitssicherheit und Gesundheitsschritt entspricht, sondern auch gesellschaftliches Engagement umfasst
- „G“ für Governance i. S. einer nachhaltigen Unternehmensführung
Bei ESG handelt es sich um nachprüfbare Kriterien, die zunehmend in Entscheidungen bei der Geldanlage einfließen bzw. einfließen sollten. Der Aspekt der „Nachprüfbarkeit“ ist hier wichtig, weil ein Greenwashing vermieden werden soll. Ein Greenwashing liegt vor, wenn sich Unternehmen gleichsam kommunikativ ein „grünes Mäntelchen“ umhängen – ihr Tun aber nach wie vor nicht umwelt- oder sozialverträglich ist.
E: Environment
Das „E“ der ESG-Kriterien steht für Environment und folglich für die Umwelt. Im Hinblick auf dieses Kriterium wird geprüft, in welchem Ausmaß sich die Aktivitäten eines Unternehmens auf die Umwelt auswirken. Hierbei geht es bspw. um den Ressourcenverbrauch insgesamt und um die Effizienz dieses Verbrauchs. Zusätzlich wird die Emission von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen untersucht.
Dieses Kriterium ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Dazu tragen zum einen die geringer werdenden Vorkommen wichtiger Rohstoffe bei. Zum anderen sehen jetzt immer mehr verantwortungsvolle Politiker ein, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Deshalb kann dieser auch nur von Menschen selbst gebremst werden. Rückgängig machen kann man den Klimawandel allerdings nicht mehr. Die Dürrephasen der letzten Jahre in Europa, spätestens aber die Katastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 hat für viele gezeigt, dass der Klimawandel nicht irgendwo – weit weg – stattfindet, sondern direkt vor unserer Haustür. Dort, aber auch weltweit mussten wir feststellen, dass der Klimawandel nicht nur mit Umweltproblemen einhergeht, sondern auch mit wirtschaftlichen Bedrohungen für ganze Länder und Kontinente.
Zum Ressourcenverbrauch und zu den Emissionen tragen allerdings nicht nur die Unternehmen bei. Auch private Haushalte verbrauchen knappe Ressourcen und emittieren Schadstoffe – beim Wohnen, beim Heizen, beim Essen, beim Surfen, beim Streamen – schlicht beim Leben.
Deshalb sollte niemand die Verantwortung für die Eindämmung des Klimawandels allein auf die Unternehmen verlagern!
Um zu prüfen, in welchem Ausmaß sich Unternehmen – heute – mit dem Thema „Environment“ befassen, können folgende Fragen gestellt werden, die sich teilweise überlagern:
- Werden Konzepte zur Reduktion der Auswirkungen des unternehmerischen Handelns auf den Klimawandel erarbeitet und/oder implementiert (u. a. Reduktion von CO2 bzw. CO2-Neutralität)?
- Werden Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt oder sind solche in Planung?
- Werden Strategien zur Steigerung der Effizienz des Ressourceneinsatzes erarbeitet und/oder implementiert (inkl. Schutz der biologischen Vielfalt)?
- Wird in Konzepte zur Kreislauf-Wirtschaft investiert, um eine Wieder- oder Weiterverwendung von Rohstoffen zu fördern (Stichwort Circular Economy)?
- Ist die Nutzung von erneuerbaren Energien in Planung und/oder im Einsatz?
- In welchem Umfang werden nachhaltige Produkte erzeugt (Nachhaltigkeit bzgl. der eingesetzten Materialien bzw. Nachhaltigkeit des Produktes selbst bzw. Nachhaltigkeit der Produktnutzung)?
- Werden nachhaltige Technologien und nachhaltige Prozesse eingesetzt oder ist deren Einsatz in Planung?
- Wird ein nachhaltiges Gebäude-Management verwendet oder ist dieses in Planung?
- Kommt ein nachhaltiges Wasser-Management zum Einsatz oder wird ein solches geplant (inkl. Wassereinsparung, Wiederverwendung/Aufbereitung, umweltfreundliche Abwasserbehandlung)?
- Werden nachhaltige Mobilitäts- und Logistik-Konzepte eingesetzt oder geplant?
In welchem Umfang sich ein Unternehmen bereits mit solchen Anforderungen beschäftigt, kann anhand verschiedener Standards ermittelt werden. Um ein Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001 einzuführen, sind vor allem die Zuständigkeiten und Abläufe des betrieblichen Umweltschutzes festzulegen. Hierzu gehören die Prozesse zur Planung, Implementierung und Kontrolle. Außerdem sind die Verantwortlichkeiten sowie Verhaltens- und Verfahrensweisen schriftlich zu dokumentieren. Noch weiterreichend ist die Orientierung am Umweltmanagementsystem EMAS. EMAS steht für das „Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung“ – in Englisch Eco-Management and Audit Scheme. Unternehmen, die hieran teilnehmen, müssen nicht nur die Anforderungen der ISO 14001 erfüllen. Zusätzlich sind Kernindikatoren des Umweltschutzes zu erfassen. Außerdem ist jedes Jahr eine Umwelterklärung zu veröffentlichen. Außerdem muss das Umweltmanagementsystem von einem zugelassenen Umweltgutachter validiert werden.
Aufgrund ihrer großen Bedeutung sollen hier die Grundlagen der Kreislaufwirtschaft vertieft werden. Die Kreislaufwirtschaft ist der Gegenentwurf zur Linearwirtschaft. Die Linearwirtschaft wird auch als „Wegwerfwirtschaft“ bezeichnet. Das dominierende Muster ist hier: nehmen, herstellen, verbrauchen, wegwerfen – und nur nicht darüber nachdenken! Dieses Modell setzt gleichsam eine unerschöpfliche Menge an billigen, leicht zugänglichen Ressourcen voraus. Dieses Vorgehen war über mehr als ein Jahrhundert das dominierende Wirtschaftssystem. In einem solchen Wirtschaftssystem werden die verarbeiteten Rohstoffe bzw. die damit erzeugenden Produkte nach ihrer Nutzung mehrheitlich entweder deponiert oder verbrannt.
In einer Kreislaufwirtschaft bzw. in der Circular Economy wird dagegen ein auf Erneuerung ausgerichteter Ansatz – gleichsam ein regeneratives System – angestrebt. Hierbei handelt es sich um ein ressourcenschonendes Produktions- und Konsumtions-Modell. Rohstoffe und Produkte sollen möglichst lange genutzt, wiederverwendet, repariert bzw. überholt/instandgesetzt (Stichwort Refurbishing für „Instandsetzung“) bzw. aufgearbeitet (Stichwort Refabrication bzw. Remanufacturing für „Wiederaufbereitung“) werden. Auch ein Recycling soll erfolgen – allerdings erst dann, wenn die Lebensdauer nicht mehr (wirtschaftlich) verlängert werden kann. Hierfür sollen Rohstoff- und Nutzungskreisläufe geschlossen werden. Zusätzlich geht es darum, nachhaltigere Designs zu entwickeln und die eingebaute Veralterung von Produkten zu beenden. Die durch eine künstliche Veralterung begrenzte technische Lebensdauer von Produkten soll Kunden nicht mehr länger zum Neukauf motivieren. Deshalb ist gleichsam ein „Recht auf Reparatur“ zu schaffen. Außerdem geht es darum, Abfälle in der Produktion und beim Konsum zu reduzieren.
Hierzu hat das EU-Parlament im Februar 2021 eine Entschließung zum neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft angenommen. Darin werden zusätzliche Maßnahmen gefordert. Ziel der EU ist es, bis 2050 eine kohlenstoffneutrale, ökologisch nachhaltige, giftfreie und vollständig kreislauforientierte Wirtschaft zu erreichen. Hierzu sollen strengere Recyclingvorschriften und verbindlichere Ziele für die Verwendung und den Verbrauch von Materialien bis 2030 definiert werden.
S: Social
Um zu prüfen, in welchem Ausmaß sich Unternehmen – heute – mit dem Thema „Social“ und folglich mit den sozialen und gesellschaftlichen Aspekten der eigenen Tätigkeiten befassen, können folgende Fragen gestellt werden, die sich ebenfalls teilweise überlagern:
- Werden die Menschenwürde, die Menschenrechte sowie die Arbeitnehmerrechte eingehalten (inkl. Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit)?
- Ist eine sichere und ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen gegeben, um den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter zu sichern?
- Wird das Prinzip der Nichtdiskriminierung in allen Unternehmensbereichen umgesetzt?
- Setzt das Unternehmen auf Diversity?
- Erfolgen eine „faire“ Behandlung und Bezahlung der Mitarbeiter – innerhalb der gesamten Lieferkette?
- Werden den Mitarbeitern umfassende Angebote zur Fort- und Weiterbildung geboten?
- Wird auf die Zusammenarbeit mit autoritären Regierungen verzichtet?
- Wird gesellschaftliche Verantwortung übernommen – über die Kernleistung des Unternehmens hinaus (Stichwort Corporate Social Responsibility), die sich in Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten niederschlagen kann?
- Steht das Unternehmen für einen fairen Umgang mit Kunden?
Ihren Niederschlag haben diese Standards bspw. in den OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen gefunden. Auch die ILO-Kernarbeitsnormen sowie die zehn Prinzipien des UN Global Compact formulieren entsprechende Anforderungen. Diese sind auch in der ISO 26000 niedergelegt, einem Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen.
G: Governance
Um zu prüfen, in welchem Ausmaß sich Unternehmen – heute – mit dem Thema „Governance“ – mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung – beschäftigen, können folgende Fragen gestellt werden, die sich ebenfalls teilweise überlagern:
- Veröffentlicht das Unternehmen die relevanten Werte und Guidelines, die der Unternehmensführung zugrunde liegen (bspw. Chancengleichheit bei Beförderungen)?
- Hält sich das Unternehmen an die einschlägigen Gesetze und Regelwerke (Compliance) und setzt auf konkrete Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Bestechung, Betrug, Geldwäsche etc.?
- Wird eine gesetzeskonforme Abführung von Steuern sichergestellt?
- Sind die Prozesse zur Steuerung und Kontrolle transparent und nachvollziehbar dokumentiert (inkl. Risiko- und Reputations-Management)?
- Liegen gut nachvollziehbare Vergütungs- und Beförderungsrichtlinien vor?
- Erfolgt nach innen und außen eine auf Transparenz ausgerichtete Kommunikation?
- Strebt das Unternehmen eine Fairness im Wettbewerb an?
- Sind die unabhängigen Kontrollorganen (bspw. der Beirat, Verwaltungsrat oder der Aufsichtsrat) ausgewogen (diverse) zusammengesetzt?
Auf für diesen Bereich wurden bereits anerkannte Standards definiert. Hierzu zählen der Deutsche Corporate Governance Kodex. Dieses Regelwerk enthält vor allem Empfehlungen und Anregungen zur guten Unternehmensführung für börsennotierte Unternehmen. Der schon erwähnte UN Global Compact enthält auch relevante Regelungen zur Governance, hier mit einem Fokus auf der Korruptionsprävention (Eintritt gegen jede Art von Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung). Die ISO 37000 definiert internationale Standards für „Good Governance“. Die G20/OECD-Grundsätze der Corporate Governance unterstützen politische Entscheidungsträger bei der Evaluierung und Verbesserung des gesetzlichen, regulatorischen und institutionellen Rahmens der Corporate Governance. Weitere Orientierung liefern der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, indem dieser einen branchenübergreifenden Transparenzstandard für die Berichterstattung über unternehmerische Aktivitäten der Nachhaltigkeit definiert. Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten werden auch durch die Global Reporting Initiative definiert.
Orientierung an den ESG-Kriterien – für das langfriste Überleben unverzichtbar
Die Tiefe der Beschäftigung mit den verschiedenen Kriterien verdeutlicht deren Relevanz – für das langfristige Überleben von Unternehmen und Menschheit gleichermaßen. Da strategische Investoren am langfristigen Überleben von Unternehmen interessiert sind, rücken die ESG-Kriterien bei Anlageentscheidungen immer mehr in den Mittelpunkt. Um Investitionsentscheidungen zu erleichtern, wird auf Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen zugegriffen. Im Gegensatz zu Rating-Agenturen wie Fitch, Moody´s und Standard & Poor´s wird ein Nachhaltigkeits-Rating nicht im Auftrag der Emittenten, sondern im Auftrag der Investoren erstellt.
In Summe kann festgestellt werden: ESG-Investments rücken stärker ins Zentrum. Es werden ESG-Fonds und ESG-ETFs aufgelegt und ESG-ETF-Sparpläne konzipiert. Der Schlüsselbegriff hierzu lautet: nachhaltige Vermögensbildung.
Aber auch Kunden verlangen – wenn auch nach wie vor auf niedrigem Niveau – nach „fairen und nachhaltigen Angeboten“. Das angestrebte „gute Gewissen“ ist hier allerdings schon viel weiter als der tatsächliche Kauf. Sonst würden Anbieter wie Primark und SheIn, die für Fast Fashion stehen, nicht nach wie vor große Erfolge erzielen. Aber ein Umdenkungsprozess hat begonnen, wenn auch sehr langsam …
Damit wird deutlich:
Die Orientierung an den ESG-Kriterien stellt längst kein Nice-to-have-Element mehr dar.
Es ist zu einem „Must have“ geworden!
Die Bitkom Akademie vermittelt mit einem neuen Workshop Einblicke in rechtliche Aspekte von ESG. Dieses Spezialseminar vermittelt einen Einblick in unterschiedliche rechtliche Aspekte von ESG und ESG Compliance. Unser interdisziplinäres und top-besetztes Referententeam (Osborne Clarke) aus dem Banken-, Gesellschafts-, Arbeits-, IP- und Vertragsrecht greift dabei verschiedene aktuelle juristische Aspekte im Zusammenhang mit ESG auf und verknüpft die diversen Themenfelder miteinander.